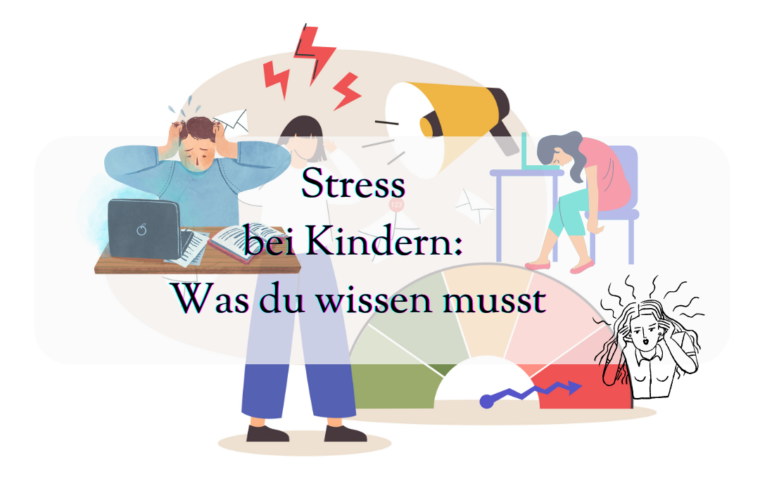credits: @ jcomp, freepic
Stress ist ein Begriff, der heutzutage im alltäglichen Sprachgebrauch omnipräsent ist. Wir reden von Beziehungsstress, Schulstress oder auch von stressigen Eltern. Doch Stress betrifft nicht nur Erwachsene – auch Kinder kennen und nutzen diesen Begriff bereits in der Grundschule. Sie klagen über „Stress mit anderen Kindern“, „Stress bei den Hausaufgaben“ oder darüber, dass „ein Lehrer stresst“. Aber was genau ist Stress? Wie entsteht er, und wie erleben Kinder und Jugendliche ihn?
Inhaltsverzeichnis
1. Was ist Stress?
Stress ist ein Begriff, der heute zum alltäglichen Sprachgebrauch gehört. Jeder kennt ihn, und fast jeder hat ihn schon einmal erlebt. Grundsätzlich ist Stress eine Reaktion unseres Körpers und Geistes auf bestimmte Herausforderungen oder Bedrohungen. Er kann sowohl durch äußere Faktoren, wie eine anstehende Prüfung oder ein Streit mit Freunden, als auch durch innere Faktoren, wie Selbstzweifel oder hohe Erwartungen an sich selbst, ausgelöst werden.
Dabei spielt die individuelle Wahrnehmung eine entscheidende Rolle. Was für den einen eine spannende Herausforderung ist, kann für den anderen eine überwältigende Belastung darstellen. Stress ist also nicht objektiv messbar, sondern hängt stark von der persönlichen Bewertung und Interpretation der Situation ab.
Für Kinder und Jugendliche ist das nicht anders. Sie erleben Stress in verschiedenen Lebensbereichen – sei es in der Schule, im Freundeskreis oder zu Hause. Schon Grundschulkinder verwenden den Begriff „Stress“ in ihrem Alltag, etwa wenn sie „Stress bei den Hausaufgaben“ haben oder darüber klagen, dass „ein Lehrer stresst“. Doch wie entsteht dieser Stress genau, und wie gehen Kinder und Jugendliche damit um?
2. Stress aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen
Wie erleben Kinder und Jugendliche Stress? Überraschenderweise geben bereits 72% der Grundschüler und 81% der älteren Schüler an, Stress zu erleben. Jüngere Schüler können jedoch seltener die Ursachen für ihren Stress benennen. Mit zunehmendem Alter werden sowohl innere Faktoren, wie Nervosität oder Überforderung, als auch äußere Faktoren, wie Zeit- oder Leistungsdruck, häufiger als Stressursachen genannt.
Kinder und Jugendliche nennen sowohl physische als auch psychische Anzeichen von Stress. Jüngere Kinder berichten häufiger von physischen Symptomen wie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, während ältere Schüler mehr über psychische Symptome wie Angst oder Unruhe sprechen. Diese Unterschiede zeigen, dass das Verständnis und die Wahrnehmung von Stress sich mit dem Alter entwickeln. Die meisten Schüler empfinden Stress negativ. 84% der jüngeren und 90% der älteren Schüler bewerten Stress als unangenehm. Dennoch gibt es auch positive Seiten: Stress kann auch als Herausforderung wahrgenommen werden, die die eigene Leistungsfähigkeit steigert. Ein gewisses Maß an Aufregung und Anspannung kann dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche sich besser konzentrieren und motiviert sind, ihre Aufgaben zu bewältigen.
Auch die Bewältigung von Stress verändert sich mit zunehmendem Alter: Ältere Schüler nennen häufiger konkrete Bewältigungsstrategien wie Ruhepausen oder veränderte Zeitplanung. Jüngere Kinder hingegen fühlen sich oft hilflos und glauben, nichts gegen ihren Stress tun zu können. Unabhängig vom Alter ist das Spektrum an bekannten Bewältigungsstrategien meist begrenzt. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, mit Stress umzugehen und geeignete Strategien zu entwickeln, um ihn zu bewältigen. Es ist hilfreich über das Thema zu sprechen, denn sowohl jüngere als auch ältere Schüler sprechen am liebsten mit ihren Eltern über Stress, wobei die Mutter eine etwas größere Rolle spielt als der Vater. Interessant ist, dass mit zunehmendem Alter Freunde als Ansprechpartner immer wichtiger werden. Dies zeigt, dass die soziale Unterstützung eine wichtige Rolle bei der Stressbewältigung spielt.

credits: @redgreystock, freepic
3. Positiver vs. negativer Stress
Stress hat einen evolutionären Sinn, da er unseren Vorfahren geholfen hat, schnell auf Bedrohungen zu reagieren – sei es durch Kampf oder Flucht. Diese Stressreaktion aktiviert den Körper und bringt uns in die nötige Aktivität, um Herausforderungen zu bewältigen. Was auf den ersten Blick nicht schlecht ist, da diese Aktivierung unsere Leistungsfähigkeit steigern kann. Dennoch nehmen die meisten Menschen Stress als negativ wahr. Die Unterscheidung zwischen positivem und negativem Stress kann jedoch hilfreich sein, um bewusster zu differenzieren und besser mit stressigen Situationen umzugehen. Positiver Stress kann uns motivieren und anspornen, während negativer Stress uns überwältigt und belastet.
3.1 Negativer Stress
Stress wird häufig mit negativen Folgen in Verbindung gebracht. Wenn wir ständig Bedrohungen wahrnehmen und der Organismus dauerhaft in einem Aktivierungszustand bleibt, kann das die körperlichen und psychischen Abwehrkräfte schwächen. Die Folgen sind oft vielfältig: Infektionen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, aber auch ernsthafte psychosomatische Beschwerden können auftreten. Eine Untersuchung zeigte, dass über 80% der befragten Schüler Stress als negativ bewerten. Diese negativen Bewertungen nehmen mit dem Alter zu, da ältere Schüler besser verstehen, wie sich Stress auf ihren Körper und Geist auswirkt.
3.2 Positiver Stress
Doch Stress hat nicht nur negative Seiten. Ein moderates Stressniveau kann unsere Leistungsfähigkeit steigern. Die Sauerstoffversorgung im Körper nimmt zu, die Reaktionsbereitschaft und Konzentration steigen an. Ein gewisses Maß an Stress kann daher sogar als angenehm und beflügelnd empfunden werden.
Für manche Menschen ist ein gewisses Maß an Stress notwendig, um überhaupt leistungsfähig zu sein. Es gibt individuelle Unterschiede hinsichtlich des bevorzugten Aktivierungsniveaus, während manche Menschen in ruhigen Umgebungen aufblühen, brauchen andere ein gewisses Maß an Trubel, um produktiv zu sein. Diese Unterschiede sind wichtig zu erkennen, denn sie zeigen, dass Stress auch positive Aspekte haben kann, wenn er richtig genutzt wird.
Ein moderates Maß an Stress kann tatsächlich positiv wirken. Stell dir vor, du hast eine wichtige Präsentation vor dir. Ein bisschen Aufregung und Anspannung können dafür sorgen, dass du dich besser konzentrierst, fokussierter bist und deine Leistung gesteigert wird. Diese Art von Stress aktiviert Leistungsreserven, die sonst möglicherweise ungenutzt bleiben würden. Der Schlüssel liegt darin, ein gesundes Maß zu finden, bei dem Stress als Herausforderung wahrgenommen wird, die motiviert und anspornt, ohne in Angst und Überforderung zu kippen. Die Balance zu finden ist da gar nicht so leicht. Doch wie entsteht dieser negative Stress, der in unserer Gesellschaft stetig ansteigt?
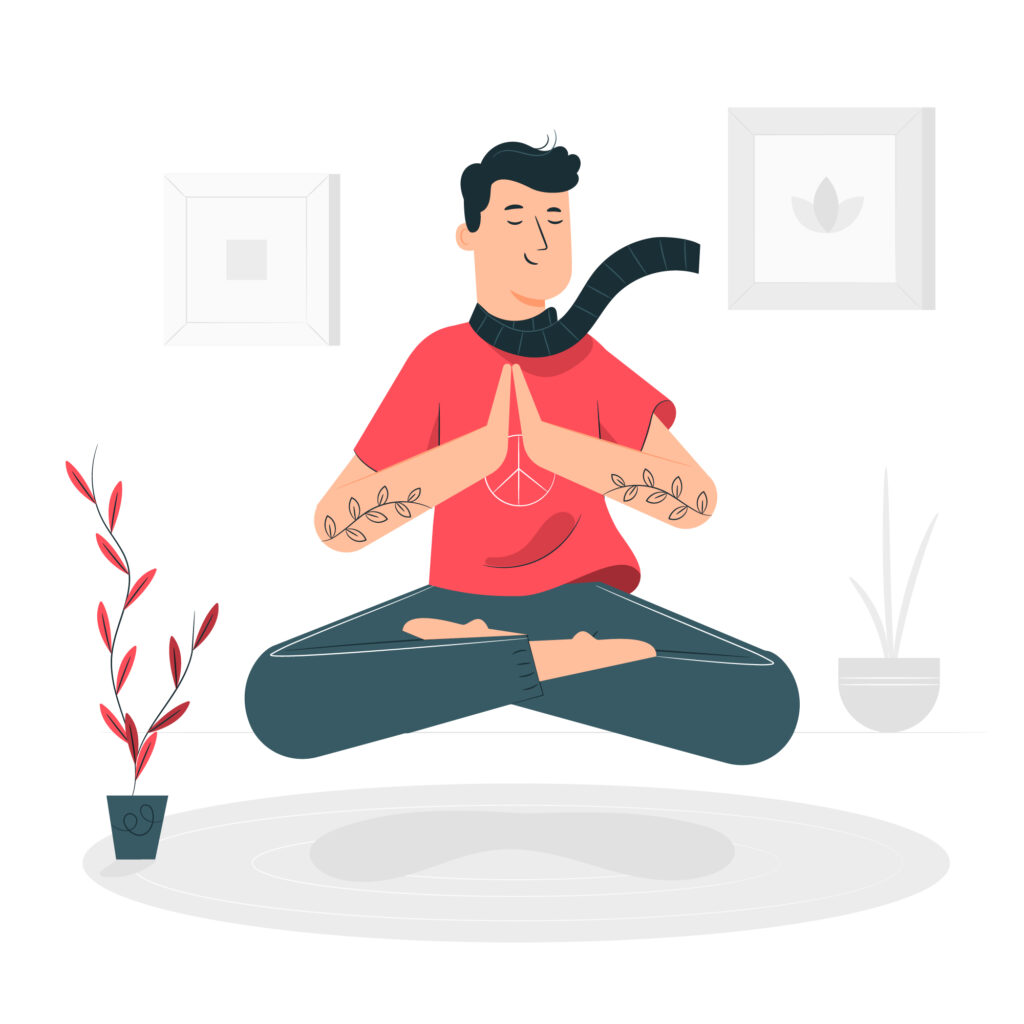
credits: @freepic
4. Wie entsteht Stress: das Stressmodell nach Lazarus
Das Stressmodell von Lazarus, auch als transaktionales Stressmodell bekannt, ist ein hilfreiches Werkzeug, um zu verstehen, wie Stress entsteht und wirkt. Nach diesem Modell ist Stress nicht direkt durch ein bestimmtes Ereignis verursacht, sondern durch die individuelle Bewertung und Interpretation des Ereignisses. Es gibt zwei zentrale Bewertungsphasen, die entscheidend sind:
Primäre Bewertung
In der primären Bewertung wird ein Ereignis zunächst als positiv, irrelevant oder stressbezogen eingeschätzt. Diese Einschätzung ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Stress empfunden werden kann. Zum Beispiel kann ein anstehender Test von einem Schüler als Herausforderung und von einem anderen als Bedrohung gesehen werden. Das zeigt, dass Stress nicht objektiv ist, sondern stark von der individuellen Wahrnehmung abhängt.
Sekundäre Bewertung
Die sekundäre Bewertung folgt der primären und betrifft die Einschätzung der eigenen Bewältigungsressourcen. Hier fragt man sich: „Kann ich das schaffen? Habe ich die nötigen Fähigkeiten und Strategien, um mit dieser Situation umzugehen?“ Ein Schüler, der weiß, wie man effektiv lernt und genug Zeit hat, wird sich weniger gestresst fühlen als ein Schüler, der sich überfordert und unvorbereitet fühlt. Diese Bewertung ist entscheidend dafür, ob eine Situation als Herausforderung oder als Bedrohung empfunden wird.
Hier ein Beispiel aus dem Schulalltag:
Stell dir vor, zwei Schüler erfahren, dass sie in drei Tagen eine wichtige Klassenarbeit schreiben müssen. Der eine Schüler weiß, wie er effektiv lernen kann, und sieht das Ganze gelassen. Er schätzt die Situation als stressig ein, aber er vertraut darauf, dass er sie bewältigen kann. Der andere Schüler hingegen fühlt sich überfordert und gestresst, weil er keine passenden Lernstrategien hat und sich in der kurzen Zeit nicht ausreichend vorbereiten kann. Hier zeigt sich, wie unterschiedlich dieselbe Situation bewertet werden kann und wie entscheidend diese Bewertungen für das individuelle Stresserleben sind.
Die Coping-Mechanismen im Lazarus-Stressmodell
Doch das Lazarus-Stressmodell erklärt nicht nur, wie Stress entsteht, sondern auch, wie wir damit umgehen können und zwar durch sogenannte Bewältigungsstrategien. Diese Strategien helfen, um mit Stress umzugehen.
Nach der Beantwortung der Fragen: „Ist das überhaupt stressig?“ und „Kann ich das schaffen?“ kommt die Frage der Bewältigung: „Wie gehe ich damit um?“ Wenn du feststellst, dass eine Situation stressig ist und du dir nicht sicher bist, ob du sie bewältigen kannst, entwickelst du Coping-Strategien. Diese Strategien können sehr unterschiedlich sein und lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen:
- Problemorientiertes Coping: Du versuchst, das Problem direkt zu lösen. Beispiel: Du hast eine schwierige Hausaufgabe und beschließt, dir Hilfe zu holen, etwa von einem Mitschüler oder Lehrer. Oder du teilst dir deine Zeit besser ein und machst einen Plan, um die Aufgabe Stück für Stück zu erledigen.
- Emotionsorientiertes Coping: Hier geht es darum, deine Gefühle zu regulieren. Beispiel: Du bist gestresst wegen der Hausaufgabe, also machst du eine kurze Pause, trinkst einen Tee oder machst ein paar Atemübungen, um dich zu beruhigen. Vielleicht redest du auch mit einem Freund darüber, um deinen Stress abzubauen.
Wie du eine stressige Situation bewältigst, beeinflusst, wie du künftige stressige Situationen wahrnimmst. Wenn du erfolgreich warst, fühlst du dich gestärkt und gehst die nächste Herausforderung mit mehr Selbstvertrauen an. Warst du weniger erfolgreich, könnte es beim nächsten Mal schwieriger sein, ruhig zu bleiben. Wie genaue Möglichkeiten aussehen, mit Stress umzugehen, dass erfährst du in den kommenden Artikeln.
Zusammenfassend ist Stress ein komplexes Phänomen, das stark von individuellen Bewertungen und Bewältigungsstrategien abhängt. Schon Kinder und Jugendliche erleben Stress und benötigen Unterstützung, um effektive Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, sie nicht vor allen stressauslösenden Situationen zu bewahren, sondern ihnen zu helfen, ein Repertoire an Bewältigungsstrategien aufzubauen. Nur so können sie lernen, mit Stress umzugehen und ihn als Herausforderung zu sehen, die sie wachsen lässt. Hier kannst du dir das Stressmodell herunterladen.
Um dein Verständnis und deine eigene Stressbewältigung zu vertiefen, kannst du dir folgende Fragen stellen:
- Wie erlebst du Stress in deinem Alltag?
- Welche Situationen lösen bei dir am meisten Stress aus?
- Welche Strategien nutzt du, um mit Stress umzugehen?
- Gibt es jemanden, mit dem du über deinen Stress sprechen kannst?
- Kannst du dir vorstellen, dass ein gewisses Maß an Stress auch positive Seiten haben könnte?
Wenn du mehr über mentales Wohlbefinden erfahren möchtest, schau dich gerne auf diesem Blog um. Schreibe mir gerne Themenvorschläge an die Mailadresse: psychologie@lea-link.de. Wenn du Interesse an einem Coaching oder einer systemischen Beratung hast, kannst du mich auch gerne kontaktieren. Bis bald!