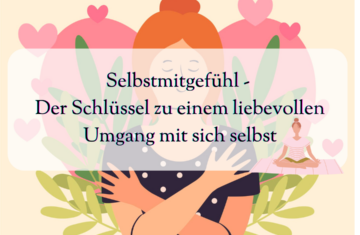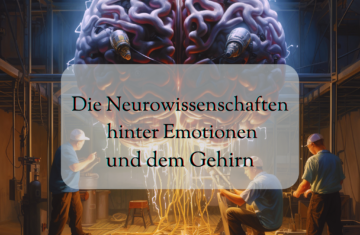credits: @macrovektor, freepic
In diesem Artikel werden die Fragen diskutiert: Wie gehe ich mit Sucht in der Familie um? Wie kann ich Suchtkranken helfen? Was brauchen Kinder suchtkranker Eltern? Wo kann ich mir Hilfe holen?
Inhaltsverzeichnis
- Schwierigkeit der Sucht: Warum Abstinenz so schwerfällt
- Belastungen der Angehörigen
- Wie kann Betroffenen im Alltag geholfen werden?
- Umgang mit der Sucht in der Familie
- Die Auswirkungen von Sucht auf Kinder und wie man sie unterstützen kann
- Tipps für den Umgang mit Sucht im Familienkreis
- Wo finde ich Unterstützung und Hilfe
1. Schwierigkeit der Sucht: Warum Abstinenz so schwerfällt
Es ist keine leichte Aufgabe, sich vom Alkohol zu lösen, besonders wenn man einmal abhängig geworden ist. Viele Menschen, die mit problematischem Alkoholkonsum zu kämpfen haben, stellen fest, dass reine Willenskraft und der feste Entschluss, den Konsum einzuschränken, oft nicht ausreichen. Der Weg aus der Sucht erfordert meist mehrere Versuche und eine umfassende Änderung des Lebensstils, wie etwa neue Strategien zur Stressbewältigung und Freundeskreiswechsel, die über das Feierabendbier hinausgehen.
Die Herausforderung der eigenen Einsicht wird oft noch durch gesellschaftliche Scham verstärkt, die zu Schuldgefühlen, Lügen und Verheimlichung des Problems führt. Bei Konfrontation mit der Suchtthematik, bekommen besorgte Angehörige oft eine Widerstandsreaktion: Unverständnis, Abblocken, Wut.
2. Belastungen der Angehörigen
Wenn man einen Angehörigen hat, der mit Alkoholproblemen kämpft, kann das Leben ziemlich überwältigend werden. Die ständigen Sorgen um die Aggressionen, die vielleicht aufflammen, die finanziellen Unsicherheiten, die mit solch einer Sucht einhergehen können, und die Angst um die Gesundheit des Betroffenen. Es fühlt sich oft so an, als müsste man seine eigenen Bedürfnisse immer wieder hinten anstellen, um die Probleme zu managen, die der Alkoholkonsum mit sich bringt.
Viele Angehörige versuchen, die Suchtproblematik nach außen hin zu verbergen, was nur noch mehr Druck erzeugt. Die Angst vor Stigmatisierung und falschen Vorstellungen führt oft dazu, dass man sich von Freunden und der Familie zurückzieht, was die Isolation und die Anforderungen noch verstärkt. Dieser ganze Stress und die ständige Belastung können zermürbend sein und das Risiko erhöhen, selbst an stressbedingten Krankheiten wie Depressionen zu erkranken.
Dazu kommt noch der Druck, verantwortlich zu sein und helfen zu müssen, was oft eine enorme Last darstellt. Das alles zu jonglieren, ohne dabei selbst unterzugehen, ist eine echte Herausforderung.
3. Wie kann Betroffenen im Alltag geholfen werden?
Wenn jemandem geholfen werden soll, der mit Alkoholproblemen zu kämpfen hat, ist es essenziell, Respekt und Verständnis zu zeigen. Diese Haltung kann nicht nur zu einer besseren Einsicht in das Problem beitragen, sondern auch den Erfolg einer Behandlung positiv beeinflussen. Es ist wichtig, keine zu hohen Erwartungen an die suchtbetroffene Person zu setzen, da dies zusätzlichen Druck erzeugt, der sich negativ auf den Heilungsprozess auswirken kann.
Aktives Zuhören, ohne sofortiges Urteilen, oder das Anbieten von Lösungen kann sehr wirksam sein. Oft ist die beste Unterstützung, einfach präsent zu sein und ein offenes Ohr anzubieten. Wenn es angebracht erscheint, sollte nicht gezögert werden, professionelle Hilfe zu empfehlen. Es gibt viele Fachleute, die auf den Umgang mit solchen Situationen spezialisiert sind.
Folgende Verhaltensweisen sind allerdings nicht förderlich: Es sollte vermieden werden, die betroffene Person durch Bestechung, Nörgeln, Weinen oder Drohungen zu kontrollieren. Auch ist es nicht zielführend, Ausreden für das Verhalten oder den Alkoholkonsum der betroffenen Person zu suchen oder diese Aspekte nach außen hin zu verheimlichen. Zudem sollte darauf geachtet werden, nicht alle Verantwortlichkeiten zu übernehmen, es sei denn, es drohen ernsthafte Konsequenzen oder gar Lebensgefahr. Es ist von großer Bedeutung, dass die betroffene Person lernt, dass ihr Verhalten Konsequenzen mit sich bringt. Sie muss lernen eigenständig mit ihren Herausforderungen umzugehen, um echte Fortschritte zu erzielen.

credits: @freepic
4. Umgang mit der Sucht in der Familie
Bei der Unterstützung von Personen mit Alkoholabhängigkeit sollten Angehörige vorsichtig sein, nicht in eine Ko-Abhängigkeit zu verfallen. Es ist unerlässlich, sich der Versuchung zu widersetzen, der betroffenen Person alle Aufgaben abzunehmen, da dies unbeabsichtigt dazu führen kann, dass deren problematisches Verhalten weiterhin aufrechterhalten wird. In einer solchen dynamischen Beziehung kann die unterstützende Haltung des gesunden Partners letztendlich dazu beitragen, dass der Trinker oder die Trinkerin das eigene Verhalten fortsetzt.
Im Umgang mit Rückfällen ist es wichtig zu verstehen, dass diese ein Teil des Genesungsprozesses sein können und nicht unbedingt einen vollständigen Misserfolg darstellen. Ein Vorfall hingegen kann als ein einmaliges Ereignis betrachtet werden, das nicht zwangsläufig zu weiteren Problemen führen muss.
Wenn häusliche Gewalt zu einem Thema in der Familie wird, sollten Unterstützungen im Außen wahrgenommen werden. In der Situation selbst, ist es entscheidend, keine provokativen Gespräche mit einer betrunkenen Person zu führen, um die Situation nicht zu eskalieren. Sollte sich die Lage verschärfen, ist es ratsam, Hilfetelefone zu nutzen und sich sowie potenzielle Opfer aus der unmittelbaren Umgebung der betrunkenen Person zu entfernen, um Sicherheit zu gewährleisten.
Angehörige müssen ebenfalls ihre eigenen Grenzen erkennen und festlegen, wie weit sie bereit sind, mit ihren Ressourcen diese Situation zu bewältigen. Es gibt keine allgemeingültige Regel dafür, wie viel eigene Unterstützung angemessen ist, da dies von den persönlichen Kapazitäten jedes Einzelnen abhängt. Erwachsene haben das Recht, ihre Grenzen selbst zu bestimmen, wohingegen der Schutz und die Sicherheit von Kindern stets höchste Priorität haben sollten.
5. Die Auswirkungen von Sucht auf Kinder und wie man sie unterstützen kann
Kinder sind äußerst sensibel und nehmen oft mehr aus ihrer Umgebung auf, als Erwachsene es vielleicht wahrnehmen. Ungewöhnliche Situationen und familiäre Konflikte, die durch Alkoholprobleme entstehen, können ihnen nicht verborgen bleiben. Daher ist es wichtig, Kinder suchtkranker Eltern angemessen aufzuklären, ohne einen Loyalitätskonflikt zu schaffen oder das suchtkranke Elternteil zu beschuldigen.
Das nicht trinkende Elternteil spielt eine entscheidende Rolle: Es sollte die Problematik nicht vertuschen, sondern offen mit dem Kind darüber sprechen, um dessen Belastung zu reduzieren. Kinder neigen dazu, Verantwortung für ihre Eltern zu übernehmen, ein Phänomen, das als Parentifizierung bekannt ist. Sie übernehmen häufig zu früh zu große Verantwortlichkeiten, manchmal auch für ihre Eltern, und sind mit dieser Rolle überfordert. Dies wird durch mangelndes Wissen über die Sucht und ihre Mechanismen verstärkt und führt dazu, dass Kinder vieles persönlich nehmen und sich oft ungerechtfertigt schuldig fühlen. Häufig versuchen sie, ihre familiären Probleme vor der Schule und ihrem sozialen Umfeld geheim zu halten. Dies hat direkte Auswirkungen auf ihre sozialen Beziehungen und ihre schulische Leistung, wobei das notwendige Vertrauen und die Verlässlichkeit, die für ihre Entwicklung essenziell sind, oft fehlen.
Es ist entscheidend, dass die Verantwortung dort belassen wird, wo sie hingehört – bei der betroffenen Person. Angehörige, insbesondere Partnerinnen und Partner, sind verpflichtet, die Kinder zu schützen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Die Hoffnung, dass sich die Situation verbessert, ist für das Wohlbefinden der Kinder von großer Bedeutung. Der Schutz der Kinder muss stets Vorrang haben, selbst wenn dies bedeutet, dass die Unterstützung für den suchtkranken Angehörigen zweitrangig wird.
6. Tipps für den Umgang mit Sucht im Familienkreis
Angehörige haben oft einen großen Einfluss auf Personen mit Suchtproblemen, da sie in der Regel die wichtigsten Bezugspersonen sind. Es ist entscheidend, sich dieser eigenen Macht bewusst zu sein und diese bewusst und verantwortungsvoll einzusetzen, um einen positiven Einfluss auszuüben, anstatt sich in die Rolle eines Mit-Therapeuten zu begeben.
- Motivation stärken: Motiviere die betroffene Person durch das Schaffen von Anreizen und positiven Motiven, die ein abstinentes Leben attraktiv machen.
- Die Kommunikation auf das Wesentliche konzentrieren: Sprich lieber über konkrete Themen ohne Vorwürfe zu machen. Erkläre die Bedeutung des Themas für die Beziehung und das gesamte familiäre Gefüge klar und sprich sorgsam und respektvoll über die Sorgen, die hinter dem Problem liegen.
- Vertrauensvolle Atmosphäre schaffen: Es ist wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, in der offene Gespräche möglich sind. Dies benötigt Vertrauen und Sicherheit von beiden Seiten. Am besten finden diese intimen Gespräche in einer ruhigen und entspannten Umgebung statt, um Spannungen zu vermeiden.
- Verständnis für die Perspektive des Betroffenen: Versuche die Sichtweise des Betroffenen zu verstehen, einschließlich seiner Einschätzung seines Trinkverhaltens und ob dieses als problematisch angesehen werden. Es ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass die Sucht oftmals nur ein verzweifelter Versuch ist, das dahinterstehende Problem zu umgehen.
- Unterstützung abstinenten Verhaltens: Unterstütze die Phasen der Abstinenz, um dem Betroffenen zu zeigen, dass ein Leben ohne Alkohol möglich und erfüllend ist.
- Grenzen setzen: Es ist wichtig, klare Grenzen zu setzen und den Betroffenen die Konsequenzen seines Verhaltens spüren zu lassen, wie beispielsweise den Verlust des Arbeitsplatzes oder von Freundschaften, um die Realität der Situation zu verdeutlichen.
- Selbstfürsorge praktizieren: Achte auf dich und deine Kapazitäten. Manchmal kann es notwendig sein, sich selbst eine Pause zu gönnen und Abstand zu gewinnen, um die eigene Gesundheit und Wohlbefinden zu schützen.

credits: @Storyset, freepic
7. Wo finde ich Unterstützung und Hilfe?
Für Personen, die Unterstützung im Umgang mit Suchtproblemen suchen, stehen zahlreiche Ressourcen und Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Hier sind einige Anlaufstellen, die hilfreich sein können:
- Selbsthilfegruppe: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet eine Suchfunktion für lokale Selbsthilfegruppen an, die Betroffenen und Angehörigen Unterstützung bieten. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite des DRK.
- Beratungsstellen: Das Suchthilfeverzeichnis der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) bietet eine umfassende Übersicht über Beratungsangebote in ganz Deutschland. Zugänglich unter . Zudem bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Informationen und Ressourcen auf ihrer Webseite (http://www.kenn-dein-limit.de).
- Telefonische Beratung: Die Sucht- und Drogen-Hotline ist rund um die Uhr erreichbar unter der Telefonnummer 01806 313 031. Der Anruf kostet zwischen 20 und 60 Cent pro Anruf.
- Onlineberatung: Caritas Deutschland bietet Onlineberatung für Menschen mit Suchtproblemen an, die Auch die BZgA stellt auf ihrer Webseite ) viele hilfreiche Ressourcen zur Verfügung.
Diese Ressourcen können wertvolle Unterstützung bieten, um mit den Herausforderungen, die Sucht mit sich bringt, besser umgehen zu können.
Wenn dir der Artikel gefallen hat und du zu mehr Klarheit über deine Situation als Angehörige/r erlangen möchtest oder du Themenwünsche hast, schreib mir gerne eine Mail an psychologie@lea-link.de.